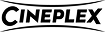Kosten & Auswahlkriterien für ein Warenwirtschaftssystem
Ob E-Commerce, stationärer Handel oder Großhandel: Eine effiziente Warenwirtschaft ist entscheidend für den Erfolg vieler Unternehmen. Doch welches ist das richtige System für mein Budget und meine Bedürfnisse?
Bei der Auswahl kommt es auf die Kosten des Warenwirtschaftssystems an. Genauso wichtig ist, dass seine Funktionen aktuelle und künftige Anforderungen abdecken. Ein unpassendes System wird schnell zum Kostentreiber, während eine gut gewählte Lösung dauerhafte Wettbewerbsvorteile mit sich bringt.
Dieser Ratgeber gibt einen Überblick über die wichtigsten Kostenfaktoren eines Warenwirtschaftssystems und erläutert verschiedene Lizenzmodelle. Außerdem beleuchtet er Unterschiede im Funktionsumfang und in Anpassungsmöglichkeiten. Ein kurzer Vergleich beliebter Systeme sorgt zusätzlich für eine erste Orientierung.
Welche Kosten fallen bei einer Warenwirtschaft an?
Die Einführung eines Warenwirtschafts- beziehungsweise ERP-Systems ist mit mehreren Kostenblöcken verbunden. Eine Kostenkalkulation sollte in jedem Fall die nachfolgenden Positionen berücksichtigen.
Überblick über die Hauptkostentreiber
Anschaffungs- oder Implementierungskosten
Die Anschaffungskosten setzen sich in der Regel aus dem Grundpreis für die Software und eventuellen Installations- und Einrichtungsgebühren zusammen. Werden bestehende Produkt- und Kundendaten in das neue System übertragen, kommen Kosten für die Datenmigration hinzu. Vielleicht ist außerdem eine Grundkonfiguration notwendig, um das Warenwirtschaftssystem an eigene Prozesse anzupassen.
Schulung der Mitarbeitenden
Ein Warenwirtschaftssystem entfaltet nur dann seine volle Wirkung, wenn es die Mitarbeiter korrekt und effizient nutzen. Werden Trainingsprogramme vernachlässigt, kommt es schnell zu Fehlern und Verzögerungen.
Wartung und Support
Für Updates, Patches und technische Unterstützung ist oft eine Support-Vereinbarung notwendig. Je nach Lizenz- oder Betreibermodell werden die Leistungen in einem monatlichen oder jährlichen Wartungsvertrag gebündelt. Die Kosten steigen, wenn Unternehmen einen speziellen Service wünschen, etwa eine 24/7-Hotline oder garantierte Reaktionszeiten.
Anpassungen an spezifische Geschäftsprozesse
Wird ein Standard-WaWi stark modifiziert, kommen Ausgaben für Programmierleistungen und Integrationstests hinzu.
Wichtig ist: Maßgeschneiderte Anpassungen können betriebliche Abläufe verbessern, erhöhen aber die Kosten bei der Einführung sowie im laufenden Betrieb. Je nach Anpassung machen sie zum Beispiel bei Softwareupdates regelmäßig Nachjustierungen erforderlich.
Hardware und Infrastruktur
On-Premise-Lösungen erfordern häufig entsprechende Server-Kapazitäten und eine stabile IT-Infrastruktur im Unternehmen. Damit einher gehen Kosten für Anschaffung, Stromverbrauch, klimatisierte Serverräume und regelmäßige Wartung. Bei einem Cloud-Modell sind diese Kosten geringer. Dafür fallen laufende Hosting- und Mietgebühren an.
Integration in bestehende Systeme
Mit Schnittstellen zu anderen Programmen (z. B. Finanzbuchhaltung, CRM, Onlineshop) lassen sich Doppeleingaben vermeiden und der Datenaustausch automatisieren. Die Entwicklung, Implementierung und Pflege dieser Schnittstellen führt zu zusätzlichen Ausgaben.
Langfristige Updates und Upgrades
Märkte, Prozesse und Technologien ändern sich stetig. Regelmäßige Updates und Funktionsupgrades sind daher unvermeidlich. In manchen Fällen lassen sich neue Funktionen in einen Wartungsvertrag integrieren, während andere Erweiterungen als kostenpflichtige Zusatzpakete angeboten werden.
Eine Schlüsselrolle bei der Investition in eine Warenwirtschaft spielt das zugrundeliegende Lizenzmodell. Es bestimmt maßgeblich darüber, welche Kosten langfristig entstehen und wie sich diese verteilen.
Einmalkosten vs. laufende Kosten: Lizenzmodelle im Überblick
Grundsätzlich lassen sich drei zentrale Lizenzmodelle bei Warenwirtschaftssystemen unterscheiden:
- der klassische Kauf (On-Premise),
- die cloudbasierte Software-as-a-Service (SaaS) und
- Hybridmodelle.
Jede Variante bietet Vor- und Nachteile.
Kauf-/On-Premise-Modelle
Ein Unternehmen erwirbt in der Regel eine unbefristete Lizenz und installiert die Software auf eigenen Servern. Es fallen hohe Einmalkosten für Lizenzen, Implementierung und gegebenenfalls Hardware an. Im laufenden Betrieb entstehen nur noch Ausgaben für Wartung und Support, insbesondere wenn Updates oder Erweiterungen hinzukommen. Außerdem besteht das Risiko, dass Updates irgendwann eingestellt werden, und ein Umstieg auf ein anderes System nötig ist. Die Kontrolle über sensible Daten verbleibt jedoch weitgehend im Haus, und Unternehmen sind nicht abhängig von Cloud-Anbietern.
- Vorteile: hohe Datensouveränität, individuelle Anpassungsmöglichkeiten, oft geringe laufende Gebühren nach der Anschaffung.
- Nachteile: hohe Anfangsinvestitionen, kontinuierliche Verantwortung für Server und Infrastruktur, zusätzliche Kosten bei größeren Updates.
Cloud- bzw. Software-as-a-Service-(SaaS)-Modelle
Bei Cloud-Varianten übernimmt der Anbieter Hosting, Wartung und Updates. Nutzer beziehen Leistungen über ein Abonnement. Damit entfallen hohe Anfangsinvestitionen für Server oder Datenbanken, und die Skalierung lässt sich flexibel anpassen. Allerdings entsteht eine starke Abhängigkeit vom Anbieter und der Verfügbarkeit der Cloud-Infrastruktur.
- Vorteile: schnelle Implementierung, kaum eigene Hardware nötig, automatische Updates, flexible Anpassung an steigende oder sinkende Nutzerzahlen.
- Nachteile: Daten liegen auf externen Servern, regelmäßige Mietkosten, Abhängigkeit von der Verfügbarkeit und Preisgestaltung des Cloud-Providers.
Hybridmodelle
Ein Hybridmodell kombiniert On-Premise-Elemente mit Cloud-Komponenten. Die Basis des Warenwirtschaftssystems – beispielsweise Kernfunktionen oder sensible Datenbanken – wird auf eigenen Servern betrieben. Zusätzlich können Funktionen über Cloud-Services hinzugebucht werden. Auf diese Weise lassen sich hohe Anschaffungskosten für Hardware reduzieren oder verteilen, ohne die volle Datensouveränität aufzugeben.
- Vorteile: flexible Nutzung zusätzlicher Funktionen aus der Cloud, Kombination aus Datensouveränität und Skalierbarkeit, reduzierte Investitionskosten für bestimmte Funktionsbereiche.
- Nachteile: je nach System höherer Integrations- und Abstimmungsaufwand zwischen On-Premise- und Cloud-Komponenten, potenzielle Doppelbelastung (Serverwartung und Cloud-Gebühren), Abhängigkeit von zwei Umgebungen bei Updates und Anpassungen.
Die Wahl des Lizenzmodells beeinflusst die langfristigen Kostenstrukturen. On-Premise-Lösungen setzen in der Regel höhere Anfangsinvestitionen voraus, ermöglichen aber mehr Kontrolle. Abo-Modelle punkten durch eine bessere Planbarkeit der monatlichen oder jährlichen Ausgaben und Hybridmodelle verbinden oft das Beste aus zwei Welten.
Zusatzmodule und Erweiterungen: Kostenfaktoren verstehen
Die Basisfunktionen eines Warenwirtschaftssystems decken häufig die wichtigsten Prozesse rund um Einkauf, Lagerhaltung und Verkauf ab. Softwareanbieter bieten zusätzlich umfangreiche Zusatzmodule und Erweiterungen an, um das System an spezifische Anforderungen anzupassen. Diese Module können den Funktionsumfang deutlich vergrößern, erhöhen aber auch die Gesamtkosten.
Typische Zusatzmodule in Warenwirtschaftssystemen
Viele Unternehmen ergänzen ihre Warenwirtschaft um Module, die auf bestimmte Prozesse zugeschnitten sind. Häufige Beispiele sind die folgenden:
CRM-Anbindung
Erweiterungen für das Kundenbeziehungsmanagement ermöglichen es Unternehmen, Kundendaten zentral zu pflegen und zielgerichtete Marketingaktionen durchzuführen.
E-Commerce-Integration
Direkte Schnittstellen zu Onlineshops und Marktplätzen erlauben einen automatisierten Datenaustausch zu Beständen, Artikeln und Bestellungen.
Finanz- und Buchhaltungsfunktionen
Wichtig für eine durchgängige Finanzabwicklung sind zum Beispiel Schnittstellen zu Buchhaltungsprogrammen und Steuerberatern.
Logistik- und Versandlösungen
Die Einbindung von Versanddienstleistern, eine Routenoptimierung oder automatisierte Versandetikettenerstellung sorgen für reibungslose Lieferprozesse.
Lizenzpolitik bei Modulerweiterungen
Manche Anbieter setzen für Zusatzmodule auf Pakete, in denen mehrere Funktionen gebündelt sind, während andere ein modulares Pay-per-Module-Konzept verfolgen. Das heißt, es wird eine Grundgebühr für jedes Modul fällig und durch laufende Gebühren für Updates und Support ergänzt.
Auch in dieser Beziehung gilt: Beide Modelle haben Vor- und Nachteile.
- Paketpreise bieten Kalkulationssicherheit. Allerdings besteht das Risiko, dass Unternehmen für Funktionen zahlen, die sie nicht nutzen.
- Einzelmodul-Lizenzen erlauben es, zielgerichtet einzelne Leistungen auszuwählen. Wenn Unternehmen mehrere Module buchen, erhöht sich der administrative Aufwand.
Individuelle Anpassungen vs. Standardlösungen
Unternehmen haben bei vielen Anbietern die Möglichkeit, neben fertigen Modulen auch passgenaue Lösungen entwickeln zu lassen. Solche individuellen Anpassungen können exakt auf spezifische Anforderungen zugeschnitten werden, bringen jedoch höhere Anfangsinvestitionen und Folgekosten mit sich. Zu berücksichtigen ist außerdem, dass es bei Updates des Systems nicht zu Schwierigkeiten kommt.
Bevor eine Entscheidung für oder gegen bestimmte Zusatzmodule fällt, ist eine systematische Kosten-Nutzen-Bewertung sinnvoll. Unternehmen sollten prüfen,
- ob das Modul wichtige Geschäftsprozesse unterstützt oder sogar Wettbewerbsvorteile mit sich bringt und
- ob sich die zusätzlichen Lizenz- und Wartungskosten langfristig lohnen oder ob vorhandene Standardmodule bereits einen Großteil der benötigten Funktionen abdecken.
Auswahl eines Warenwirtschaftssystems - wichtige Evaluierungskriterien
Vor der Auswahl eines Warenwirtschaftssystems ist es entscheidend, den eigenen Bedarf gründlich zu definieren und auf dieser Grundlage verschiedene Lösungen zu vergleichen.
Dabei spielen neben den Kosten und Lizenzmodellen weitere Kriterien eine zentrale Rolle.
Branchenspezifische Anforderungen
Nicht jedes System passt zu allen Geschäftsmodellen. Unternehmen im E-Commerce brauchen beispielsweise leistungsfähige Schnittstellen zu Onlineshops und Marktplätzen, während in einem Großhandelsbetrieb eine ausgefeilte Lager- und Logistikverwaltung im Fokus steht. Spezialisierte Lösungen bieten oft branchentypische Funktionen, die in Standardprodukten fehlen oder nur über teure Zusatzmodule verfügbar sind.
Skalierbarkeit und Flexibilität
Warenwirtschaftssysteme sind meist über mehrere Jahre oder sogar Jahrzehnte im Einsatz. Wenn ein Unternehmen wächst, international expandiert oder neue Geschäftsbereiche eröffnet, sollte sich die Software leicht an diese Veränderungen anpassen lassen.
In diesem Zusammenhang sind zwei Fragen entscheidend:
- Stellt das System ausreichend Kapazitäten bereit, etwa für steigende Nutzerzahlen oder ein wachsendes Artikelsortiment?
- Können Unternehmen problemlos weitere Module oder Schnittstellen hinzubuchen, ohne dass Kernprozesse beeinträchtigt werden?
Benutzerfreundlichkeit und Support
Eine Software kann noch so umfangreich sein: Wenn sie umständlich zu bedienen ist, werden Mitarbeiter Schwierigkeiten haben, damit effizient zu arbeiten. Außerdem ist der Schulungsaufwand dann hoch. Ein zuverlässiger Support verhindert kostspielige und langwierige Ausfälle.
Sicherheit und Datenschutz
Ein Warenwirtschaftssystem muss hohe Anforderungen an Sicherheit und Datenschutz erfüllen. Es muss konform mit Datenschutzbestimmungen (DSGVO) und gegebenenfalls branchenspezifischen Richtlinien sein. Ebenfalls wichtig sind technische Sicherheits-Features wie eine Verschlüsselung, regelmäßige Backups und ein Berechtigungssystem.
Wirtschaftlichkeit im Gesamtpaket
Es lohnt sich, verschiedene Szenarien durchzuspielen – etwa zukünftige Wachstumspläne oder mögliche Geschäftserweiterungen – um einschätzen zu können, ob die Software auch dann noch die richtige ist. Ein günstiges Einsteigermodell kann im Nachhinein teure Nachrüstungen erfordern. Allerdings haben kleine und mittelständische Unternehmen meist andere Ressourcen zur Verfügung als Konzerne.
Die richtige WaWi-Software ist letztlich das Resultat einer individuellen Abwägung: Welche Funktionen müssen unbedingt vorhanden sein, welche können als Module zugekauft werden und wie steht es um den erforderlichen Datenschutz? Eine sorgfältige Planung und eine transparente Evaluation der genannten Kriterien schaffen die Voraussetzungen für eine nachhaltige Investition.
Vergleich von WaWi-Anbietern
Der Markt für Warenwirtschaftslösungen ist vielfältig und entwickelt sich stetig weiter. Neben etablierten Playern treten regelmäßig neue Anbieter auf, die mit innovativen Funktionen oder besonders attraktiven Lizenzmodellen werben. Dennoch gilt: Keine „Universallösung“ deckt alle Bedürfnisse gleichermaßen ab.
Kriterien für den Anbietervergleich
Bei der Gegenüberstellung verschiedener Warenwirtschaftssysteme sollten mehrere Aspekte berücksichtigt werden:
Funktionsumfang
Verfügt die Software über die erforderlichen Kern- und Zusatzfunktionen? Bietet sie sinnvolle Erweiterungen oder branchenspezifische Module?
Kostenstruktur
Wie setzen sich Einmalkosten und laufende Gebühren zusammen? Welche Lizenzmodelle sind verfügbar (z. B. Kauf, Cloud, Hybrid,)? Manchmal sind scheinbar günstige Warenwirtschaftssysteme langfristig mit hohen Kosten verbunden.
Anpassungsfähigkeit
Lässt sich das System flexibel auf künftige Anforderungen zuschneiden oder branchenspezifisch erweitern?
Benutzerfreundlichkeit
Wie intuitiv ist die Bedienung, und wie hoch ist der Schulungsaufwand?
Support und Service
Welche Service-Level werden angeboten (z. B. 24/7-Hotline, garantierte Reaktionszeiten)? Sind Updates und Wartung im Preis enthalten?
Referenzen und Zuverlässigkeit
Sind bereits erfolgreiche Projekte bei vergleichbaren Unternehmen bekannt? Welche Erfahrungen schildern Anwender in Foren oder Bewertungsportalen?
Fünf ausgewählte WaWi-Systeme im Überblick
Für eine Orientierungshilfe zum Einstieg und erste Einschätzungen stellen wir nachfolgend 5 beliebte Warenwirtschaftssysteme vor:
1. Lexware Warenwirtschaft
Kurzbeschreibung:
Lexware ist für einfache Finanz- und Buchhaltungslösungen bekannt. Die Lexware Warenwirtschaft eignet sich als Einstiegs- oder Aufsteigerlösung für kleine Unternehmen.
Lizenzmodell:
Meist als Abonnement (jährliche Gebühr), beinhaltet regelmäßige Updates und Online-Funktionen wie den Datenaustausch mit Steuerberatern oder Banken.
Zielgruppe:
Kleinere Firmen, Handwerksbetriebe und Freiberufler, die eine solide Basislösung mit Fokus auf die deutsche Gesetzgebung suchen.
Besonderheiten:
Bekannt für einfache Bedienbarkeit und Integration ins Lexware-Softwareökosystem (Buchhaltung, Lohn & Gehalt). Limitierte Skalierbarkeit im Vergleich zu größeren ERP-Systemen.
2. JTL-Wawi
Kurzbeschreibung:
JTL-Wawi ist eine leistungsstarke Warenwirtschaft mit Fokus auf den E-Commerce-Bereich und gehört zu den führenden Warenwirtschaftssystemen in Deutschland. Sie bietet eine zentrale Plattform zur Verwaltung sämtlicher Geschäftsprozesse – vom Einkauf über Lager und Versand bis hin zum Verkauf über Onlineshops und Marktplätze. Die Software kann Schritt für Schritt angepasst, erweitert und optimiert werden.
Lizenzmodell:
Die Grundversion der Software ist kostenlos – zusätzliche Module, Services und Auftragsvolumina können kostenpflichtig hinzukommen.
Zielgruppe:
Kleine bis große Unternehmen, die im Onlinehandel tätig sind und ihre Produkte zusätzlich auf zahlreichen Marktplätzen oder auch stationär anbieten wollen.
Besonderheiten:
Umfangreiche Community, regelmäßige Updates, gute Skalierbarkeit für wachsende Onlinehändler, zahlreiche Automatisierungslösungen.
3. weclapp
Kurzbeschreibung:
weclapp ist eine Cloud-ERP-Software mit integriertem WaWi-Modul.
Lizenzmodell:
Rein cloudbasiert (SaaS), mit monatlicher oder jährlicher Abrechnung. Verschiedene Paketpreise für unterschiedliche Module (CRM, Finanzbuchhaltung, etc.).
Zielgruppe:
Kleine und mittlere Unternehmen, die eine schnelle Implementierung wünschen und keine eigene Server-Infrastruktur betreiben wollen.
Besonderheiten:
Einfache Benutzeroberfläche, modularer Aufbau und schneller Support. Branchenneutrale Ausrichtung mit Fokus auf Service und Automatisierung.
4. Sage 100
Kurzbeschreibung:
Sage 100 ist eine etablierte Lösung mit starkem Fokus auf den deutschen Mittelstand. Neben dem klassischen Warenwirtschaftskern sind auch Finanzbuchhaltung, Lohnabrechnung und CRM-Features erhältlich.
Lizenzmodell:
Sowohl On-Premise- als auch Cloud-Varianten möglich. Bei On-Premises fallen einmalige Lizenzkosten sowie Wartungsgebühren an, bei der Cloud-Lösung eine Abonnementgebühr.
Zielgruppe:
Mittelständische Unternehmen unterschiedlicher Branchen, die ein umfassendes ERP- und WaWi-Paket suchen.
Besonderheiten:
Hohe Anpassungsfähigkeit, guter Support durch deutsche Niederlassungen, langjährige Marktpräsenz.
5. Pixi
Kurzbeschreibung:
Pixi (von Descartes) ist speziell auf E-Commerce und Fulfillmentprozesse ausgerichtet. Neben klassischen WaWi-Funktionen bietet es umfangreiche Automatisierungen für Lager, Versand und Retouren.
Lizenzmodell:
Üblicherweise Cloudbasiertes Modell mit monatlichen Gebühren; individuelle Erweiterungen können hinzukommen.
Zielgruppe:
Vor allem Onlinehändler und Fulfillment-Dienstleister, die komplexe Lager- und Versandstrukturen automatisieren möchten.
Besonderheiten:
Starke Ausrichtung auf Versandprozesse mit hohen Volumina sowie Lagerautomatisierung. Breite Anbindungsmöglichkeiten an gängige Shopsysteme (z. B. Shopify, Magento) und Marktplätze.
1. Praxisberichte
Erfahrungsberichte anderer Unternehmen oder Fallstudien liefern wertvolle Einblicke in die tatsächliche Leistungsfähigkeit einer WaWi-Lösung. Sie helfen abzuschätzen, wie sich Implementierung, Support und Kosten in der Praxis darstellen. In vielen Fällen stehen solche Erfahrungswerte auf den Websites der Anbieter selbst oder in einschlägigen Fachportalen zur Verfügung.
2. Testzugänge und Demoversionen
Die meisten Anbieter stellen Testkonten (vorrangig bei Cloud-Lösungen) oder Demoversionen (häufig bei On-Premise-Varianten) bereit. Dadurch lässt sich vorab klären, ob die Software sowohl technisch als auch funktional überzeugt. In dieser Phase können zudem wichtige Prozesse (z. B. Artikelanlage, Auftragsabwicklung, Lagerbuchungen) unter realen Bedingungen ausprobiert werden.
3. Pilotprojekte
Gerade bei komplexeren Anforderungen oder größeren Unternehmen ist ein Pilotprojekt empfehlenswert. Dabei wird die Software in einem abgegrenzten Bereich (z. B. einer einzelnen Abteilung oder einer Tochtergesellschaft) implementiert. Auf diese Weise lassen sich Prozesse testen, Anpassungsbedarf identifizieren und das Schulungskonzept optimieren – ohne das Risiko gleich auf den gesamten Geschäftsbetrieb zu übertragen.
Ein direkter Vergleich von Funktionen, Kosten und Referenzen sorgt für die nötige Transparenz, um eine fundierte Entscheidung über das Warenwirtschaftssystem zu treffen. Dabei ist stets abzuwägen, inwieweit das System zukunftssicher aufgestellt ist, ob es die geforderten Sicherheits- und Datenschutzaspekte erfüllt und wie flexibel es bei wachsendem Funktionsbedarf reagiert.
Ob ein Warenwirtschaftssystem das richtige für die eigenen Bedürfnisse ist, hängt von vielen Faktoren ab. Ein bloßer Preisvergleich von Warenwirtschaftssystemen reicht nicht. Die Gesamtbetrachtung muss Kostenaspekte, funktionale Anforderungen, Sicherheit und Skalierbarkeit einschließen.
Für die richtige Wahl sollten Unternehmen zunächst die eigenen Anforderungen definieren: Wie hoch ist das geplante Budget? Welche Funktionen werden kurz- und langfristig benötigt? Wie viel Kontrolle über die Daten ist erforderlich und wie wichtig ist es, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren?
Ein sorgfältiger Auswahlprozess, der neben Kosten und Funktionsumfang auch Aspekte wie Support-Qualität und Datensicherheit bewertet, bildet die Grundlage für eine nachhaltige Investition. Pilotprojekte, Testversionen und Erfahrungsberichte anderer Nutzer stellen wertvolle Hilfsmittel dar, um Fehler zu vermeiden und die Software zu finden, die sowohl aktuellen als auch künftigen Anforderungen gerecht wird.
Schließlich gilt: Die Entwicklungen im Bereich Warenwirtschaft bleiben dynamisch. So eröffnen etwa innovative Technologien wie Künstliche Intelligenz oder Automatisierungslösungen neue Möglichkeiten. Wer den Markt beobachtet und vorausschauend plant, kann von diesen Trends profitieren und seine Warenwirtschaft strategisch so ausrichten, dass sie langfristig Wettbewerbsvorteile sichert.