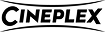Die Warenwirtschaft als Schaltzentrale im Unternehmen
Ein effizientes Warenwirtschaftssystem ist das Herzstück vieler Unternehmen. Als zentrale Steuerungsinstanz für Einkauf, Lager und Vertrieb entscheidet es maßgeblich darüber, ob Bestellungen pünktlich bearbeitet werden, Bestände aktuell bleiben und Kunden zufrieden sind.
Diese Seite gibt eine Einführung in die zentralen Aufgaben eines Warenwirtschaftssystems. Sie zeigt Integrationsansätze für Einkauf, Lager und Vertrieb auf und erklärt, wie Echtzeitdaten Entscheidungsprozesse verbessern.
Außerdem befasst sie sich damit, wie eine zentrale Steuerung dazu beiträgt, Lieferketten zu optimieren, und warum Skalierbarkeit eine entscheidende Eigenschaft von Warenwirtschaftssystemen ist.
Die zentrale Rolle der Warenwirtschaft im Unternehmensalltag
Die Warenwirtschaft überwacht, steuert und koordiniert sämtliche Warenbewegungen in einem Unternehmen.
Damit greift sie in alle klassischen Unternehmensbereiche von Handelsunternehmen ein:
- Einkauf / Bestellwesen
- Produktion / Fertigung (sofern vorhanden)
- Lager / Bestandsmanagement
- Verkauf / Vermarktung
- Verwaltung / Administration
Die wichtigsten Aufgaben einer Warenwirtschaft
Eine Warenwirtschaft hat mehrere Kernaufgaben, die eng miteinander verzahnt sind:
Bestandsführung (Warenein- und -ausgänge, Lagerverwaltung)
Das Fundament jeder Warenwirtschaft ist die Bestandsführung: Das System dokumentiert alle Warenbewegungen von der Anlieferung bis zum Versand an den Kunden. Das Resultat: eine exakte Bestandsübersicht, die vor Über- oder Unterbeständen schützt. Außerdem minimiert ein Warenwirtschaftssystem Warte- oder Suchzeiten, weil es dafür sorgt, dass Ware stets am richtigen Ort und zur richtigen Zeit verfügbar ist.
Artikelverwaltung und Sortimentspflege (Katalogmanagement, Produktinformationen)
Ein effizientes Warenwirtschaftssystem unterstützt Unternehmen dabei, ihre Produkte übersichtlich zu organisieren und laufend zu aktualisieren. Es pflegt Stammdaten wie Artikelnummern, Preise oder Beschreibungen und sorgt für ein konsistentes Erscheinungsbild – zum Beispiel in Online-Shops oder Print-Katalogen. Zusatzinformationen wie Produktbilder, Lagerbestände und Aktionspreise lassen sich automatisiert verwalten. Das Ergebnis ist ein aufgeräumtes, kundenfreundliches Sortiment, das es Unternehmen erlaubt, flexibel auf Marktveränderungen zu reagieren.
Beschaffung und Einkauf (Lieferantenmanagement, Bestellprozesse)
Ein gutes Warenwirtschaftssystem verwaltet Lieferanten-Stammdaten und wichtige Informationen zu Einkäufen, zum Beispiel Verträge, Preise und Absprachen. Je nach System lassen sich Analysen durchführen, um Lieferanten zu bewerten. Außerdem dient die Software dazu, Bestellprozesse durchzuführen und Akteuren in der Supply Chain aktuelle Daten zur Verfügung zu stellen.
Vertrieb und Verkauf (Auftragsabwicklung, Kundenmanagement)
Das Warenwirtschaftssystem erfasst und verarbeitet Bestellungen so, dass Kunden ihre Ware zeitnah erhalten. Es stellt automatisch Informationen zu Verfügbarkeiten, Versandoptionen und Lieferterminen bereit. Ein Kundenmanagement (oft Teil eines CRM-Moduls) fördert den Aufbau langfristiger Geschäftsbeziehungen, indem es Kundendaten bündelt und Verkaufsprozesse reibungslos in das Gesamtsystem integriert.
Rechnungsstellung und Zahlungsabwicklung (Schnittstelle zur Buchhaltung)
Schließlich stellt eine Warenwirtschaft sicher, dass jede Transaktion ordnungsgemäß abgerechnet wird. Dazu erstellt das System automatisch Rechnungen, Gutschriften oder Mahnungen. Zahlungseingänge und offene Posten sind immer nachvollziehbar. Es kommt zu weniger Fehlern, etwa durch manuelle Doppeleingaben; der Abgleich mit der Buchhaltung erfolgt nahezu in Echtzeit.
Die Hauptziele einer Warenwirtschaft sind die folgenden:
- Sicherstellung der materiellen Liquidität
- Prozessoptimierung und Effizienzgewinne
- Zeit- und Kostenersparnis sowie Fehlerreduktion
- Transparenz und Auswertungsoptionen
Effiziente Prozesse durch die Integration von Einkauf, Lager und Vertrieb
Damit eine Warenwirtschaft ihre Aufgaben erfüllt, ist die nahtlose Integration verschiedener Unternehmensbereiche notwendig. Der Echtzeit-Austausch von Daten zwischen Einkauf, Lager und Vertrieb spielt dabei eine Schlüsselrolle.
Warum ist die Integration so wichtig?Transparente Prozesse
Durch eine einheitliche Datenbasis lassen sich Warenein- und -ausgänge schneller nachverfolgen. Dadurch sind auch präzisere wirtschaftliche Prognosen (Forecasts) möglich.
Weniger Fehler
Doppelarbeit oder Fehlinformationen werden minimiert. Alle Bereiche greifen auf denselben Datenbestand zu und Daten werden in Echtzeit aktualisiert.
Zeitersparnis
Arbeitsabläufe beschleunigen sich, weil manuelle Abstimmungsprozesse und aufwendige Kontrollen entfallen.
Hohe Servicequalität
Kurze Lieferzeiten und verlässliche Angaben zum Warenbestand steigern die Kundenzufriedenheit.
Transparenz
Weil Verantwortliche zu jeder Zeit über Bestellungen im Bilde sind, können sie früh auf Änderungen in der Nachfrage reagieren und Einkaufsprozesse bei Bedarf neu ausrichten. Es kommt nicht dazu, dass Händler Artikel verkaufen, die nicht mehr im Lager vorhanden sind (Überverkäufe) und Kunden durch Stornierungen oder lange Lieferzeiten verärgern. Umgekehrt vermeiden es Unternehmen, dass sie zu viele Artikel einkaufen und teuer lagern müssen.
Informationsfluss
Unternehmen erhalten aktuelle Informationen über die Leistungsfähigkeit, Qualität und Preise von Lieferanten. Dies erleichtert strategische Entscheidungen im Einkauf, sorgt für bessere Konditionen und beugt bösen Überraschungen vor.
Tempogewinn
Automatisierte Workflow-Ketten beschleunigen die Abwicklung von Aufträgen. Zum Beispiel lösen Bestellungen automatisch Folgeprozesse wie die Erstellung von Rechnungen oder den Druck von Versandlabels aus. So können Händler die steigenden Anforderungen von Kunden an die Geschwindigkeit von Lieferungen erfüllen.
Auch auf einer anderen Ebene ist Integration ein wichtiges Erfolgskriterium: dann, wenn Unternehmen auf mehreren Kanälen verkaufen.
Omnichannel: Integration aller wichtigen Kanäle durch die Warenwirtschaft
Heute nutzen Konsumenten neben klassischen Ladengeschäften verschiedene Onlinekanäle, um Produkte zu entdecken und zu erwerben. Umso wichtiger ist es für Unternehmen, auf diesen Kanälen präsent zu sein und ihre Zielgruppe dort abzuholen, wo sie sich gerade aufhält. Ein zentrales Warenwirtschaftssystem stellt das Bindeglied zwischen Onlineshop, Online-Marktplätzen und Ladengeschäften dar.
Reibungslose Prozesse durch eine einheitliche Datenbasis
Eine zentrale Herausforderung im Omnichannel-Umfeld besteht darin, sämtliche Angebote und Bestände in Echtzeit zu synchronisieren. Wer parallel im eigenen Onlineshop, auf Marktplätzen wie Amazon oder eBay und im stationären Handel verkauft, muss sicherstellen, dass Lagerbestände korrekt abgebildet sind. Sonst steigt das Risiko der schon angesprochenen Überverkäufe. Hier kommt die Warenwirtschaft ins Spiel: Ein zentrales Warenwirtschaftssystem liefert eine einheitliche Datenbasis, mit der sämtliche Verkäufe, Retouren und Warenein-/-ausgänge gesteuert werden.
Verfügbare Artikel werden automatisch über alle Kanäle hinweg synchronisiert und sämtliche Aufträge laufen in einem System zusammen. Das beschleunigt die Abwicklung und reduziert Fehlbestände.
Verbesserte Kundenerfahrung
Ein weiterer wichtiger Aspekt einer erfolgreichen Omnichannel-Strategie ist die Kundenzufriedenheit. Wer zu Hause online einkauft, erwartet beispielsweise dieselben Preise und Produktinformationen wie im Laden vor Ort. Flexible Abhol- und Rückgabemöglichkeiten (z. B. „Click & Collect“) steigern die Kundenbindung zusätzlich.
Mit einer gut angebundenen Warenwirtschaft lassen sich solche Services zuverlässig umsetzen.
Weniger Aufwand dank zentraler Steuerung
Dank einer zentralen Steuerung lassen sich viele Abläufe automatisieren, die manuell mit enormem Zeit- und Personalaufwand einhergehen.
Integration mit Warenwirtschaft: technische Aspekte
Nur mit der richtigen Technik sind wichtige Daten überall, wo sie gebraucht werden, sofort vorhanden:
Cloud-Lösungen
Cloud-basierte Warenwirtschaftssysteme erlauben den Zugriff an beliebigen Standorten und Geräten. Sie sind in der Regel einfach skalierbar. Unternehmen können mit wenigen Klicks Mitarbeiter hinzufügen beziehungsweise entfernen oder die Speicherkapazität verändern.
Apps
Mithilfe von Apps für Smartphones und Tablets können Anwender unterwegs einen Auftragsstatus oder den Lagerbestand einsehen. Mitarbeiter im Außendienst haben die Möglichkeit, direkt bei Kunden Bestellungen aufzunehmen und Lieferungen anzustoßen. Alles, was sie dafür benötigen, ist eine Internetverbindung.
Automatisierte Schnittstellen
Professionelle Warenwirtschaftssysteme besitzen Schnittstellen, um externe Plattformen an das System anzubinden, zum Beispiel Online-Shops, große Online-Marktplätze oder Versanddienstleister.
Barcode-Scanner
Barcode-Scanner beschleunigen Warenein- und -ausgänge im Lager, beugen Eingabefehlern vor und stellen eine lückenlose Nachverfolgbarkeit sicher.
Optimierung von Lieferketten durch zentrale Steuerung
Die Effizienz einer Lieferkette (Supply Chain) hängt maßgeblich von einem durchgängigen Informationsfluss und gut aufeinander abgestimmten Prozessen ab. Eine zentral gesteuerte Materialwirtschaft trägt dazu bei, Abläufe zu vereinheitlichen und Engpässe schneller zu erkennen. Dadurch profitieren selbst kleine und mittlere Unternehmen, die oft weniger Reserven für Verzögerungen und Fehlplanungen haben, von einem strukturierten Supply-Chain-Management.
Exkurs: Was ist eine Lieferkette (Supply Chain)?
Eine Lieferkette umfasst alle Schritte, die ein Produkt vom Rohstofflieferanten bis zum Endkunden durchläuft. Dazu gehören Beschaffung, Produktion, Lagerhaltung, Distribution und Verkauf. Der Begriff wird häufig mit Großunternehmen in Verbindung gebracht. Aber ein effizientes Supply Chain Management ist auch für kleinere Betriebe unverzichtbar.
Die Vorteile einer Warenwirtschaft für die Lieferkette:
1.
Dank präziser Daten lässt sich die Produktion oder Beschaffung flexibel anpassen. Ware wird genau dann geliefert, wenn sie benötigt wird. Lagerzeiten und Kosten reduzieren sich.
2.
Unternehmen können Bestellungen zu größeren Lieferungen zusammenfassen. Dadurch beugen sie Leerfahrten vor, schonen die Umwelt und verringern Frachtkosten.
3.
Ein systematisches Management der Transportwege verhindert Verzögerungen und ermöglicht pünktliche Lieferungen.
4.
Zoll- und Retourenprozesse lassen sich mithilfe automatisierter Dokumentationen effizienter handhaben.
5.
Wenn alle Beteiligten (z.B. Lieferanten, Spediteure, interne Abteilungen) auf dieselben Informationen zugreifen, sinkt das Risiko für Fehllieferungen oder falsche Prognosen.
6.
Alle Warenströme lassen sich lückenlos nachverfolgen – der Aufwand für Abstimmungen fällt geringer aus.
Das Ergebnis: Mehr Effizienz, weniger Kosten
Eine strukturierte Steuerung der Lieferkette erhöht die Profitabilität von Unternehmen. Kurze Lieferzeiten, geringe Lagerkosten und eine reibungslose Auftragsabwicklung schaffen finanzielle Vorteile und stärken das Vertrauen der Kunden in Lieferprozesse. Langfristig kann dies zu einem klaren Wettbewerbsvorteil führen.
Skalierbarkeit als wichtige Eigenschaft von Warenwirtschaftssystemen
Wenn ein Unternehmen wächst, ändern sich häufig die Anforderungen an seine Warenwirtschaft. Prozesse werden komplexer und Geschäftsmodelle entwickeln sich weiter, Lager werden erweitert und bestehende Verkaufskanäle durch neue ergänzt.
Ein skalierbares, in die eigene IT-Infrastruktur eingebundenes Warenwirtschaftssystem lässt sich einfach an diese Veränderungen anpassen. Statt Engpässe zu riskieren oder auf ein neues System umzusteigen, können Unternehmen die vorhandene WaWi-Lösung erweitern.
Bedeutung von Skalierbarkeit für unterschiedliche Unternehmensgrößen
Unternehmen unterschiedlicher Größe und in unterschiedlichen Phasen haben verschiedene Bedürfnisse
- Gründungsphase: Am Anfang ist weniger oft mehr. Ideal sind kostengünstige Lösungen, die intuitiv bedienbar sind und schnell einen Überblick bieten. Gleichzeitig denken umsichtige Gründer in die Zukunft.
- KMU: Mit zunehmendem Umsatz und einer wachsenden Produktpalette steigen die Anforderungen an Lagerverwaltung, Bestellabwicklung und Reporting.
- Konzern: Größere Strukturen brauchen umfassende Module für internationale Geschäfte, automatisierte Prozesse und anspruchsvolle Analysen.
Grundsätzlich ist es in der digitalen Gegenwart für Handelsunternehmen wichtiger denn je, sich rasch an neue Gegebenheiten anzupassen und zum Beispiel ihr Angebot oder ihre Prozesse zu ändern. Agilität ist das Gebot der Stunde. Mit einem skalierbaren Warenwirtschaftssystem bleiben Unternehmen beweglich.
Anforderungen an eine skalierbare Warenwirtschaft
Skalierbarkeit in Hinsicht auf Warenwirtschaftssysteme bedeutet vor allem folgendes:
- Modulares Systemdesign oder erweiterbare Software
Ein modular aufgebautes System ermöglicht es, genau die Funktionen hinzuzufügen, die in einer bestimmten Wachstumsphase notwendig sind. Neue Module für Lagererweiterungen, E-Commerce-Anbindungen oder Buchhaltungsfunktionen lassen sich flexibel integrieren, ohne das System austauschen zu müssen.
Ein Start-up in der Gründungsphase kann eine Basisversion buchen und diese später erweitern. Große Konzerne haben die Freiheit, ihre Warenwirtschaft schnell an neue Strategien und Absatzmärkte anzupassen.
- Anpassungsfähigkeit an neue Verkaufskanäle
Wächst das Unternehmen, kommen oft Marktplätze, neue Online-Shops oder internationale Vertriebskanäle hinzu.
Eine skalierbare Warenwirtschaft bietet die notwendigen Schnittstellen dafür. Sie lässt sich ohne großen Aufwand an veränderte Geschäftsmodelle anpassen.
Warenwirtschaftssysteme schaffen die Voraussetzungen für effiziente Prozesse
In einer Zeit, die von Globalisierung, Digitalisierung und Omnichannel geprägt ist, brauchen Handelsunternehmen ein zentrales System, das einen Echtzeit-Überblick über alle wichtigen Daten aus Einkauf, Lager und Vertrieb ermöglicht.
Nur mit einem guten Warenwirtschaftssystem stellen sie sicher, dass Bestände aktuell sind und Prozesse fehlerfrei und effizient ablaufen. Dadurch sparen sie Ressourcen und erfüllen Kundenerwartungen. Ein Warenwirtschaftssystem trägt auch dazu bei, die eigene Supply Chain zu optimieren.
Der Schlüssel dazu ist eine reibungslose Integration verschiedener Geschäftsbereiche und Verkaufskanäle. Mit einem skalierbaren System ist diese langfristig gegeben. Unternehmen bleiben agil und können ihre Warenwirtschaft flexibel an neue Anforderungen anpassen. Gute Voraussetzungen, um dauerhaft wettbewerbsfähig zu bleiben.